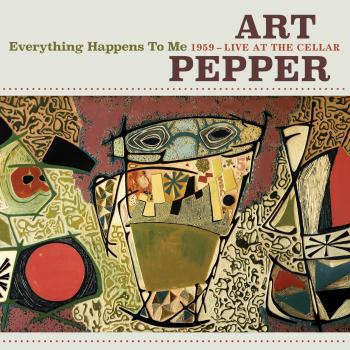Beethoven: Symphony No. 7 Berliner Philharmoniker and Kirill Petrenko
Album Info
Album Veröffentlichung:
2020
HRA-Veröffentlichung:
25.09.2020
Label: Berlin Philharmonic Orchestra
Genre: Classical
Subgenre: Orchestral
Interpret: Berliner Philharmoniker and Kirill Petrenko
Komponist: Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Das Album enthält Albumcover
- Ludwig van Beethoven (1770 - 1827): Symphony No. 7 in A Major, Op. 92:
- 1 Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: I. Poco sostenuto. Vivace 13:31
- 2 Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: II. Allegretto 07:41
- 3 Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: III. Presto. Trio I und II. Assai meno presto 08:27
- 4 Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: IV. Allegro con brio 08:01
Info zu Beethoven: Symphony No. 7
Noch ist er nicht offiziell im Amt. Doch Kirill Petrenko, designierter Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, lässt es sich nicht nehmen, bei der Saisoneröffnung 2018/2019 sein zukünftiges Orchester zu dirigieren. Mit den beiden Tondichtungen Don Juan sowie Tod und Verklärung von Richard Strauss stehen zwei Werke auf dem Programm, die sich durch eine raffinierte, farbenreiche und schillernde Instrumentation auszeichnen. Sie gelten als Paradestücke für Orchester. Ideal für Kirill Petrenko und die Berliner Philharmoniker, gemeinsam die ganze Pracht des orchestralen Zusammenspiels zu entfalten.
Beide Werke gehören zu der Gruppe jener Tondichtungen, mit denen der junge Richard Strauss das Genre der Programmmusik zu neuen Höhen führte und seinen Ruhm als einer der ersten Komponisten seiner Zeit begründete. Don Juan, der literarische Archetypus des spanischen Frauenhelden, inspirierte zahllose Dichter und Komponisten. Strauss beschreibt eindrucksvoll die Entwicklung des Protagonisten, vom ungestümen, leidenschaftlichen Frauenjäger zum innerlich zerrissenen, lebensüberdrüssigen Mann. Tod und Verklärung wiederum schildert die letzten Stunden eines Todkranken, seine Schmerzen, seine Erinnerungen an schönere Lebenstage und schließlich sein Sterben. Beide Werke haben die Berliner Philharmoniker übrigens kurz nach den Uraufführungen in Weimar 1889 und Eisenach 1890 unter der Leitung des Komponisten gespielt, sie gehören somit quasi zur musikalischen DNA des Orchesters. Dass Strauss die Chance bekam, seine Tondichtungen in Berlin aufzuführen, verdankte er seinem Mentor Hans von Bülow, dem damaligen Chefdirigenten der Philharmoniker. Wenige Tage bevor Strauss seinen Don Juan dirigierte, hatte Bülow das Werk bereits in einem philharmonischen Abonnementkonzert vorgestellt und damit das Missfallen des selbstbewussten Komponisten erregt, der seinen Eltern schrieb: »Also Bülow hat mein Werk in Tempi, in allen total vergriffen, von dem poetischen Inhalt keine Ahnung [...].«
Als Strauss seine beiden Tondichtungen schrieb, stand er am Anfang einer phänomenalen Karriere; Ludwig van Beethoven hingegen hatte bereits den Gipfel des Ruhms erklommen, als er seine Siebte Symphonie komponierte. Mit ihrem optimistischen, mitreißenden und schwungvollen Gestus riss sie bereits bei der Uraufführung 1813 das Publikum zu Beifallsstürmen hin. Der Rezensent der Wiener allgemeinen musikalischen Zeitung konstatierte, dass die Symphonie »in allen Teilen so klar, in jedem Thema so gefällig und leicht faßlich ist, daß jeder Musikfreund, ohne eben Kenner zu seyn, von ihrer Schönheit mächtig angezogen wird, und zur Begeisterung entglüht«.
»Bei Beethoven heißt Sonate: Instrumentaldichtung«
Prolog in der Provinz: Manche Orte entfalten einen Zauber, der sich schwer erklären lässt; als würde dort im Verborgenen ein Geist wirken und die Anwesenden zu Gedanken und Taten anregen, die ihnen anderswo nicht eingefallen wären. In der südthüringischen Stadt Meiningen gab es solch einen Genius loci, und seine menschliche Verkörperung war Herzog Georg II. (1826 – 1914) von Sachsen-Meiningen. Mit seinem Amtsantritt 1866 übernahm Georg für fast fünf Jahrzehnte auch die Verantwortung für das Meininger Hoftheater und erfand im Grunde das, was wir heute unter Theaterregie verstehen. Er führte sein Schauspielensemble mit Musteraufführungen und europaweiten Tourneen zu Weltruf und ging selbst als »Theaterherzog« in die Geschichte ein.
Was Georg mit seinen Schauspielern gelungen war, das wollte er auch mit seiner Hofkapelle erreichen. 1880 sah er den Augenblick dafür gekommen: Hans von Bülow (1830 – 1894) nahm die Einladung an, neuer musikalischer Leiter der Kapelle zu werden. Den Herzog und den Musiker einte das Ziel, ein Orchester zu schaffen, das in der Lage wäre, den Werken ebenbürtige Interpretationen zu verleihen; und beide waren sich auch darin einig, womit das zu bewerkstelligen sei, nämlich mit der Musik Ludwig van Beethovens. In seiner ersten Saison als Hofkapellmeister setzte Bülow daher ausschließlich Beethoven-Werke aufs Programm – eine, wie er es scherzhaft nannte, »Reise um Beethoven in 80 Tagen«, kulminierend in dem legendären Konzert im Dezember 1880, in dem er die Neunte Symphonie gleich zwei Mal spielen ließ.
In einem programmatischen Brief an seinen zukünftigen Dienstherrn stellte Bülow seine Absicht in einen größeren Zusammenhang: »Gewissermaßen gehöre ich der Meininger Schule an, habe es mir, teils instinktiv, teils vorsätzlich angelegen sein lassen, die Meininger Prinzipien in meiner Hauptsphäre zur Geltung zu bringen […] Eine Beethoven’sche Symphonie ist in meiner Auffassung ein Drama für die hörende Phantasie.« Musik war für Bülow mehr als »tönend bewegte Form«, und theatralisch muss auch sein Dirigierstil gewesen sein, expressiv alle Möglichkeiten gestischer und mimischer Darstellung nutzend. Diese »Dirigentenpantomimik«, wie Bülow sie selbst nannte, diente ihm der »Verdeutlichung der satz- und orchestertechnischen Komplexität« (Hans Joachim Hinrichsen). So hob er einzelne Orchesterstimmen hervor, stellte Motive heraus und kontrastierte Formabschnitte, indem er das Tempo teils erheblich modifizierte. So entstand ein »rhetorisch-analytischer und agogisch extrem differenzierter Vortragsstil« (Hinrichsen), der eine große sinnliche Wirkung hervorgebracht und der Musik eine sprechende Qualität verliehen hat: eben ein »Drama für die hörende Phantasie«.
Die Neuheit ist präsent vom ersten Moment an: Beethovens Siebte Symphonie
Viel spricht dafür, dass Bülow damit ganz nah an Beethovens eigener Intention war. Aus der Widmung der Eroica an Napoleon und fast mehr noch aus ihrer vehementen Tilgung (1804) ist deutlich abzulesen, wie Beethoven seine Musik inhaltlich mit Gestalten seiner Gegenwart verknüpfte, und schon die Szenenangaben zur Pastorale sind Nachweis genug. Aber auch in den programmlosen Symphonien finden sich Indizien, zumal in seiner Siebten, die Bülow besonders intensiv studiert hat. Viele Musikschriftsteller haben das Tänzerische, Fröhliche, Überschäumende in ihr betont; Robert Schumann etwa fühlte sich von ihr »in den Tanzsaal« geführt, Richard Wagner sprach gar von der »Apotheose des Tanzes«. Beethovens Schüler Carl Czerny hingegen betont, das Werk verdanke »den damaligen Zeitereignissen« seine Entstehung. Und das waren nicht nur Napoleons beginnende Eroberungsfeldzüge gen Osten (die Partitur ist datiert »1812, 13ten« [April]), sondern vor allem der sich formierende Widerstand gegen die französische Besatzung: »Schade, dass ich die Kriegskunst nicht so verstehe wie die Tonkunst; ich würde ihn doch besiegen«, hatte Beethoven dem Usurpator schon 1806, nach der Schlacht von Jena und Auerstädt, angedroht.
Schon für Beethoven galt, was Richard Strauss später für sich selbst konstatierte: dass er mit jedem Werk die Gattung neu zu erfinden hatte, oder in Strauss’ Worten: »sich bei jedem neuen Vorwurfe auch eine dementsprechende Form zu schaffen«. Die Neuheit ist präsent vom ersten Moment der langsamen Einleitung an – die längste, die er je komponiert hat. Hector Berlioz sprach von einem Beginn, »wie man ihn sich origineller nicht vorstellen kann«: Aus einem Orchesterschlag erblüht die Oboenmelodie, die schon im vierten Takt ein rhythmisches Motiv andeutet, das sich, in manchen Varianten, durch das ganze Werk zieht: ein Daktylus – mal auf einer Tonhöhe, mal melodisch figuriert, mal auf dem Taktschwerpunkt beginnend, mal auftaktig gedacht, in jedem Falle so omnipräsent, dass der Musikhistoriker August Wilhelm Ambros für das ganze Werk den Beinamen »Symphonie dactylique« vorschlug. Mit dem raffinierten Übergang in den schnellen Teil entwickelt sich ein zwingender Sog, der so weit geht, dass sich gar kein eigentliches kontrastierendes Seitenthema ausbildet. Und doch gibt es eine Stelle, die heraussticht, wenn auch gerade im Leisen: In der Reprise wiederholt die Oboe in etwas anmutigerer Weise das gerade im Fortissimo wiederaufgenommene Hauptthema; dann ändert sich mit einem Mal die Farbe. Nach Moll gewendet und Pianissimo, über langgehaltenen Begleitakkorden der Streicher, alternieren die Holzbläser im Wechsel mit einem aus dem Hauptthema abgespaltenen Motiv: für einige Augenblicke legt sich ein Schatten über das übermütige Springen.
Im zweiten Satz wirkt dieser Schatten nach, doch ist das Stück trotz des aus dem Daktylus entwickelten Schrittmotivs keineswegs ein Trauermarsch: Die Tempovorschrift lautet Allegretto (und nicht, wie oft zu hören, Andante oder gar Adagio). Bei der Uraufführung 1813 gefiel dieses Allegretto so sehr, dass es sogleich wiederholt werden musste. Eine Musik wie ein Kondukt aus verfremdender Distanz: eine Klage im Konjunktiv über Opfer, die noch gar nicht gefallen sind – mit einem sich Schicht um Schicht auftürmenden Thema in einer Art Variationenform, zwei Mal unterbrochen durch ein tröstlich-mildes Nebenthema, das gleichwohl den schreitenden Rhythmus beibehält.
Das Scherzo steht in der weit entfernten Tonart F-Dur: der erste Scherz, den sich Beethoven mit diesem im Presto dahinrasenden Satz erlaubt. Dass der Trio-Teil ohne Vorwarnung in die Grundtonart A-Dur wechselt, ist schon der zweite Schabernack. Wie schon in der Fünften Symphonie belässt es Beethoven nicht bei einer dreiteiligen Form, sondern bringt Scherzo und Trio zwei Mal im Wechsel. Die letzte Schelmerei kommt am Schluss: Da täuscht der Komponist gar eine dritte Wiederholung des Trios an und knallt dann mit fünf Orchesterschlägen den Deckel zu – ein Paradebeispiel von Beethovens an Haydn geschulter Lust an der Irreführung des Publikums. Das Finale greift diese Schläge auf und stürzt sich in einen Allegro-Furor, dessen »con brio«-Vorschrift wörtlich zu verstehen ist: Das Thema schleudert dem Hörer die Noten um die Ohren, der Rhythmus dominiert alles, die in ihrer Atemlosigkeit fast fetzenhaften Melodien werden wie weggefegt vom vorwärtsdrängenden Impetus: ein »mitreißender Sieges- und Jubelgestus«, in dem »noch einmal ›élan terrible‹ und ›éclat triomphal‹ der französischen Revolutionsmusik Gestalt werden« (Joachim Großkreutz).
Berliner Philharmoniker
Kirill Petrenko, Dirigent
Keine Biografie vorhanden.
Dieses Album enthält kein Booklet